Tagungsbericht der Jahrestagung 2016 in Hamburg
Die Diskussionen über gescheiterte Projekte sind trotz Ergebnisbericht der Reformkommission der Bundesregierung in vollem Gange. Nach der letzten Jahrestagung in 2015 über das Thema „Projektcontrolling aus Sicht des Auftraggebers“ hat die 1. Wissenschaftliche Vereinigung dieses Jahr Strategien des Risikomanagements analysiert und aus verschiedenen Perspektiven diskutiert.
In der Bewertung der derzeitigen Diskussion in Wissenschaft und Praxis besteht über die Notwendigkeit eines funktionierenden Risikomanagements großes Einvernehmen. Die wesentliche Frage dabei ist jedoch, mit welcher Methodik, in welcher Tiefe, zu welchen Zeitpunkten und in welcher projektbezogenen Konstellation die Umsetzung erfolgt. Diese Fragen wurden von renommierten Referenten aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht, um daraus abschließend gemeinsam Thesen zur Anwendung abzuleiten.
Ulrich Wölfer von Unibail-Rodamco Germany GmbH, Düsseldorf stellte das Projekt
Überseequartier Hamburg
als eines der momentan größten Projekte in Deutschland vor. Das multifunktionale Projekt besteht aus Handelsflächen, Hotel mit 800 Zimmern, Büroflächen, Entertainment und Kino mit 2.700 Plätzen, 500 Wohnungen sowie umfangreichen Gastronomieflächen. Das Projekt mit ca. 260.000 m2 BGF wird eine Investition von knapp 1 Mrd. € umschließen. Das Projekt wird von 12 renommierten, zum Teil international tätigen Architekten gestaltet und beinhaltet alle klassischen Baurisiken, die bei einem derartigen Projekt allerdings weit über das normale Maß hinausgehen. Dies betrifft neben dem Planungsrisiko durch sehr viele unterschiedliche Planungsbeteiligte, naturgemäß die Entwicklung des Bebauungsplanes auch im Dialog zwischen den verschiedenen Stakeholdern und der Stadt. Des Weiteren hervorzuheben ist das Betreiberrisiko in den verschiedenen oben angesprochenen Nutzungsstrukturen. Neben der Vielzahl der Risiken wurde deutlich, dass es sich um ein fantastisches Projekt in einer der schönsten Städte Europas handelt und damit die Entwicklung einer internationalen Landmark für Hamburg beinhaltet.
Norbert Grahl von der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg referierte zum Thema
Projektentwicklungen – Risikobewertung aus Perspektive der finanzierenden Bank.
Entscheidend für die finanzierende Bank ist die Bewertung der vorgesehenen Projektplanung und das Risikomanagement des jeweiligen Kunden. Darauf aufbauend erfolgt die eigene Bewertung der Bank im Hinblick auf das Fertigstellungsrisiko und einem von der Bank eventuell zu tragendem Ausfallrisiko. In diesem Prozess ist entscheidend, nicht tragbare Risiken rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zu eliminieren sowie tragbare Risiken zu begrenzen und zu bewerten. In dem Zusammenhang wird auch über einen „Sicherheitspuffer“ für unplanmäßige Entwicklungen nachgedacht. Das projektbegleitende Risikomanagement vergibt die Bank an geeignete Dienstleister, die für eine laufend aktuelle Transparenz der Werthaltigkeit der Kreditforderung sorgt. Dabei geht es auch um die Bewertung von Planungsänderungen des Kunden und daraus resultierenden Anpassungen der Finanzierungsstruktur. Wesentlich ist die Möglichkeit, frühzeitig auf erhöhte bzw. eingetretene Ausfallrisiken zu reagieren.
Jens Quade von Ed. Züblin AG, Hamburg stellte das Risikomanagement verschiedener Projekte aus
Perspektive der ausführenden Firma
dar. Nach seiner Wahrnehmung der letzten zwei Jahrzehnte gab es nur wenige Auftraggeber bzw. Projektsteuerer in Deutschland, die in klassischen Vergabeverfahren auf Risiken hingewiesen, hinterfragt oder gar deren finanzielle Bewertungen abgefordert haben. In der letzten Zeit ergäbe sich allerdings durch alternative Vergabeverfahren, partnerschaftliche Vertragsmodelle und veränderte Marktbedingungen bzw. die Internationalisierung der Branche in dieser Richtung ein Kulturwandel. Herr Quade erläuterte sehr anschaulich die Verfahren der Risikoerkennung, der Risikobeurteilung und Kompensationsüberlegungen, die Risikosteuerung und Risikoüberwachung im Hause Züblin durch ausgewählte Tools und Definition von Verantwortlichkeiten. Bei einem Neubau eines mulitifunktionalen Gebäudes in Kopenhagen verlangte der Bauherr von allen Anbietern eine Risikoanalyse mit kombiniertem Kompetenz-/Preiswettbewerb auf Basis eines vom Auftraggeber vorgegebenen Risikoregisters. Diese Struktur musste von den Bietern mit der Monte-Carlo-Simulation im Hinblick auf die Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet werden. Des Weiteren diente diese Struktur als Basis zu einer Pauschalierung des Risikobudgets und wurde kontinuierlich während der Bauphase analysiert. Quades Fazit bestand in der Feststellung, dass das Risikomanagement kein „Hexenwerk“ sondern eine Frage von Struktur und Bearbeitungstiefe sei. Das größte Risiko beim Bauen ist und bleibt der Mensch, wobei die beste Risikovorsorge in Form von offenen und qualifizierten Mitarbeitern und verantwortungsbewussten Managern besteht.
Dirk Schaper (HOCHTIEF ViCon GmbH, Essen) berichtete über den Einsatz von
Building Information Modeling
Die Methodik bietet durch strukturierte Datenerfassung und -führung in wesentlichen Teilbereichen die Möglichkeit, Risiken zu mindern. Dies betrifft insbesondere Störungen durch das Erfordernis, bei konventioneller Abwicklung Daten mehrfach zu transformieren sowie Kollisionen in der Planung frühzeitig zu identifizieren und einer Lösung zuzuführen. Des Weiteren liegen Vorteile in der gemeinsamen Datenumgebung und dadurch resultierende die Möglichkeiten in der Erhöhung der Planungssicherheit. Damit ergibt sich ein höheres Maß an Transparenz und auch hilfreiche Lösungsunterstützungen durch Projekttypisierungen. Herr Schaper erläuterte dies anhand der äußerst komplexen Planungs- und Abwicklungsabläufe im Projekt der Elbphilharmonie. Dort mussten im Hinblick auf mehrdimensionale Krümmungen in der Dachkonstruktion und Verknüpfungen zwischen Stahlbau und Technik vielfältige Lösungen ingenieurmäßig durchdacht werden, die ohne die Methodik BIM sehr schwierig zu lösen gewesen wären.
Univ.-Prof. Dr. Ing. habil. Christian Moormann, Universität Stuttgart erläuterte Verfahren des
Risikomanagement beim Bauen in Boden und Fels
in Konkretisierung des Schadensfalles “Historisches Archiv Stadt Köln” und Strategien zur Reduktion der Risiken im Spezialtiefbau. Herr Prof. Moormann erläuterte sehr anschaulich die Herausforderungen der Geotechnik, die Schwierigkeit, Zuverlässigkeit und Risiko in der Geotechnik zu quantifizieren, Lehren aus dem Schadensfall Köln zu ziehen und Strategien zur Reduktion der Risiken zu formulieren. Rückblickend lassen sich folgende häufige Schadensursachen identifizieren:
- auf ein Minimum reduzierte Baugrunderkundung,
- geringe Planungstiefe bei Ausschreibungen,
- Antreffen abweichender Baugrundverhältnisse während der Ausführung ohne Anpassung der Planung,
- Auffälligkeiten während der Bauausführung ohne geeignete Gegenmaßnahmen,
- kein Vier-Augen-Prinzip während der Ausführung und damit gekoppelte Defizite in der Qualitätssicherung,
- Organisationsdefizite in der gesamten Projektorganisation (QM-System),
- unzureichender fachlicher Dialog innerhalb der Organisation zwischen AG/AN/Sonstigen.
Den Abschluss der Tagung stellte traditionell die
Vorstellung und Besichtigung zweier Großbaustellen mehr lesen


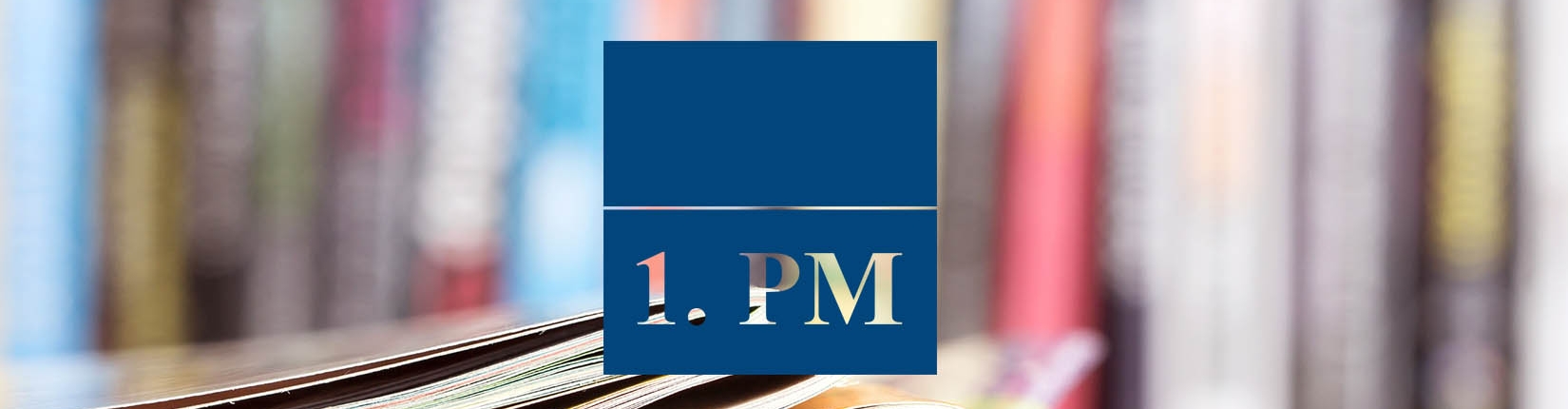
 Der Bau- und Immobilienmarkt hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Dies zeigt sich insbesondere in folgenden Punkten:
Der Bau- und Immobilienmarkt hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Dies zeigt sich insbesondere in folgenden Punkten:
